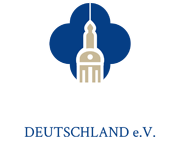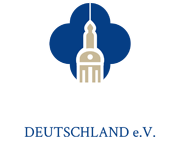Photo von der Ecke Charlottenstraße 60 / Mohrenstraße 21-23 ca. 1902 mit den verbliebenen barocken Häusern. Lage GMaps.
Quelle: https://sammlung-online.stadtmuseum.de/Details/Index/296979
Diese barocken Häuser wurden alle ersetzt, wobei das Eckhaus heute noch steht, sogar mit Teilen der historistischen Dekoration.
"Das Geschäftshaus Charlottenstraße 60 hat 1907 die Berlinische Bodengesellschaft nach Plänen des Büros Cremer & Wolffenstein errichten lassen. Die ursprüngliche Gliederung der Sandsteinfassaden, ein Raster aus Stützen, Trägern und Fensterflächen, ist trotz der späteren Veränderungen wie dem Ersatz von vorgewölbten Fensterflächen durch einfache Fenster noch weitgehend erkennbar...An der abgeschrägten Hausecke zum Gendarmenmarkt ist das Gebäude mit einer großen Kartusche über dem Hauptgesims und einer Merkurbüste über dem Eingang ausgezeichnet." Quelle

Quelle: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Ber…llschaft_05.jpg