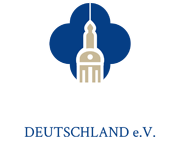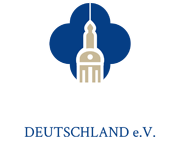Jetzt passt es. Sehr aufschlussreich ist das Bild mit dem Zuganker. Schön zu sehen, wie sich dahinter das Backsteinmauerwerk des 17. Jh. verbirgt, das dann mit den Industrieziegeln des 19. Jh. verblendet wurde.
Beiträge von tegula
-
-
Ja, kann ich bestätigen. Nur eines der vier Bilder wird angezeigt. Der Quelltext ist korrekt, aber die Bilder werden nicht geladen.
-
Deine Aussage: wer sich in seinem Leben weit rechts geäußert hat, gehört an den öffentlichen Pranger, sobald er sich für ein Bauwerk einsetzt, das nichts mit ebendiesen Äußerungen zu tun hat.
Nein, gewiss nicht meine Worte. Ganz im Gegenteil:
Auch die Tatsache, dass die Überprüfung Bödeckers nach Eröffnung des Humboldt-Forums und fünf Jahre nach dem Tod des Spenders erfolgt, lässt an persönliche Motive eines Mannes denken, der sich mit der vollendeten historisierenden Rekonstruktion des Berliner Schlosses nicht abfinden möchte.
-
Als Ausländer frage ich mich, weshalb man überhaupt die Gesinnung von Spendern thematisieren und wie ein scharfer Rottweiler in der Privatsphäre dieser Spender herumschnüffeln muss.
Niemand schnüffelt in der Privatsphäre der Menschen herum. Um das vielzitierte Beispiel Bödecker heranzuziehen, so sind lediglich seine öffentlichen Statements herangezogen worden. Und das gilt auch für alle anderen Spender. Was denn auch sonst? Willst du ernsthaft behaupten, man hat die Menschen im Wohnzimmer oder am Telefon belauscht? Jetzt sollten wir mal bei der Wahrheit bleiben.
-
Es geht ja darum, Rekonstruktionsprojekte wie das Berliner Schloss eine möglichst breite Akzeptanz in der Mitte der Gesellschaft zu ermöglichen. Das erreicht die Stiftung sicher nicht dadurch, dass man die Existenz rechter, rechtsradikaler und vielleicht sogar rechtsextremer Spender kategorisch leugnet. Es ist weitaus klüger, mit dieser Tatsache offen umzugehen und Transparenz an den Tag zu legen. Denn nur auf diese Weise kann man glaubhaft kommunizieren, dass alle weitergehenden Anschuldigungen einer Grundlage entbehren. Hier setzt man dann mit Gegenargumenten an. Man macht sich aber von Beginn an unglaubwürdig, wenn man die Augen vor den real existierenden Spendern verschleißt. Das hat der Förderverein viel zu spät begriffen und die Stiftung möchte nun nicht den gleichen Fehler begehen und geht mit den Anschuldigungen offensiv und transparent um.
-
Ich sehe nirgendwo gelbe Ziegel. Oder wurden die verbliebenen gelben Ziegel im 19. Jahrhundert rot gestrichen, und damals nur ein Teil der originalen Ziegel durch rote Industrieziegel ersetzt? Die Ziegelflächen am obersten Geschoss sehen unregelmässig aus, weshalb ich vermute, dass hier die originalen Ziegel überdauert haben, aber lediglich mit einem roten Anstrich versehen.
Ich befürchte, das erste Foto ist zu unscharf, um dort genauere Aussagen zu treffen. Aber zumindest auf dem zweiten Foto sehen wir komplett den Klinker des 19. Jh. Auf dem obigen Foto, auf dem man schön sehen kann, dass man bereits von oben begonnen hat, die Steine abzuschlagen.kann man auch gut nachvollziehen, wie im 19. Jh. üblicherweise Backsteinwände erneuert wurden. Es wurden nur die äußeren Schichten ausgetauscht und der meist intakte Mauerkern blieb bestehen. Die Frage ist dann nur, wie gut verzahnt wurde und ob sich daraus Feuchtigkeitsprobleme ergeben.
-
Die Industriesteine haben zur Feuchtigkeitsschaden an der Fassade geführt, weil die Fassade nicht "atmen" konnte. Deshalb hat die Denkmalpflege zugestimmt.
Das habe ich ja bereits weiter oben vermutet. Somit ist alles im grünen Bereich. Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die dänische Denkmalpflege so etwas ohne Not absegnet.
Was Dresden betrifft: Hier wurde nicht der Vorkriegszustand des Hofes rekonstruiert.
Solange dabei nicht ganze Zustände rückgebaut werden, kann man das in Einzelfällen durchaus diskutieren. Und in Dresden scheint man da doch zu einer überzeugenden Lösung gekommen zu sein. Ich kann damit mittlerweile gut leben, wenn ein solcher Prozess wissenschaftlich seriös begleitet wird.
-
Das hört sich nach Dehio an. Dann bist du wohl auch über den Grossen Schlosshof in Dresden sehr geärgert?
Das hört sich nach internationalen Standards der Denkmalpflege an. Mich wundert es, dass man sich in Dänemark scheinbar darüber hinwegsetzt und frage mich, ob es dafür auch nachvollziehbare Gründe gibt. Die Ästhetik reicht dafür sicher nicht. Zu Dresden: Hat man im Dresdner Schlosshof Zustände des 19. Jahrhunderts rückgebaut? Ich bin da nicht im Detail informiert.
-
Hier wird ganz einfach wieder der Überbringer der schlechten Nachricht geköpft.
Wieso schlechte Nachrichten? Für wen sollen sie schlecht sein? Diese Erwiderung ist überfällig gewesen und ganz sicher im Sinne der meisten Rekonstruktionsfreunde. Zudem ist sie deutlich und dennoch respektvoll verfasst. Viel besser geht es nicht. Ich würde mir solche Statements häufiger wünschen.
-
Und sie ist sachlich und unaufgeregt erfolgt. So muss man mit der Thematik umgehen! Das schafft Seriosität und Überzeugungskraft.
-
Das würde wohl kaum statisch machbar sein. Wenn ich es richtig verstanden habe, sollte nur die oberste oder die obersten Backsteinschichten, die aus der Mitte des 19. Jh. stammten, ausgetauscht werden. Soweit so gut, aber die industriell gefertigten Ziegel sollten durch Handstrichziegel ersetzt werden, was natürlich eine erhebliche Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes zur Folge hätte. Unabhängig davon, ob das ästhetisch zum Vorteil wäre, würde man damit ein über 160 Jahre alten Zustand des Gebäudes rückbauen.
-
Die (übrigens deutsche Industrieziegel aus 1860) sehen viel zu glatt aus. Daher begrüsse ich die Massnahme.
Industrieziegel dieser Zeit sehen nun mal so aus. Eine solche frühe denkmalpflegerische Maßnahme ist selbst längst Teil der Geschichte und der Substanz des Bauwerks. Da dieser Rückbau eigentlich nicht mir den Standards der Denkmalpflege vereinbar ist, frage ich mich, ob es halt gewichtigere Gründe gab, hier einzugreifen. Hat das Gebäude durch diese Ziegelschicht vielleicht mittlerweile Schaden genommen, weil möglicherweise die Luftzirkulation nicht mehr gewährleistet war oder Feuchtigkeit eindringen konnte? In einem solchen Fall wäre eine so eingreifende Maßnahme sicher gerechtfertigt.
-
Ich möchte hier einige Impressionen von Kulturdenkmälern auf Rügen ablegen: Bäderarchitektur, Kirchen, Schlösser, Herrenhäuser
Vollständig und einem textlichen Kontext kann man die Abbildungen hier studieren:
 Kultur und Natur auf RügenRügens Kulturlandschaft: Mönchgut, Granitz, Jasmund, Wittow, Hiddensee, Kreidefelsen - Dorfkirchen, Bäderarchitektur, Schlösser, Herrenhäuserwww.zeilenabstand.net
Kultur und Natur auf RügenRügens Kulturlandschaft: Mönchgut, Granitz, Jasmund, Wittow, Hiddensee, Kreidefelsen - Dorfkirchen, Bäderarchitektur, Schlösser, Herrenhäuserwww.zeilenabstand.netDorfkirche Altenkirchen
Dorfkirche Schaprode
Dorfkirche Wiek
Marienkirche Bergen
Jagdschloss Granitz
Jagdschloss Granitz: Wendeltreppe im Mittelturm
Schloss Spyker
Seebrücke Sellin
Kurhaus Binz
Strandpromenade Binz
-
Aus Sicht der Denkmalpflege ist ein Rückbau eines Zustandes aus der Mitte des 19. Jahrhunderts höchst fragwürdig. Arbeitet man in Dänemark mit anderen Standards? Oder gab es vielleicht konservatorische Gründe für diese Maßnahme?
-
Zumindest sehe ich es so, man darf mir natürlich gerne widersprechen.
Ich hinterfrage mal, erneut auf die Gefahr hin, dass irgendein Nutzer glaubt, mich deshalb persönlich angehen zu dürfen und zu müssen. Folgende Anmerkungen und Fragen habe ich:
Die Gleichheit aller Menschen ist gewiss keine sozialdemokratische Doktrin. Sie ist vielmehr bereits in den Menschenrechtskonventionen verankert. Auch in der jüdisch-christlichen Überlieferung spielt die Gleichheit aller Menschen eine zentrale Rolle. Mir ist schon bewusst, dass es Gleichheit auf verschiedenen Ebenen geben kann, aber wie man die Würde des Menschen mit einer Doktrin in Verbindung setzen kann, ist mir schleierhaft. Könnerschaft und Begabung können selbstredend auch in einer Gesellschaft Anklang finden, die die Prinzipien der Gleichheit aller Menschen für ein zentrales Element des Miteinanders ansieht. Im Grunde gilt das mehr oder weniger ausgeprägt für alle kapitalistischen Demokratien.
Eine künstlerische Meisterschaft bedingt doch keine natürliche Hierarchie, wie du schreibst. Vielmehr ist diese Hierarchie eine Frage der gesellschaftlichen Bedingungen. Bis ins Hochmittelalter hinein zum Beispiel galt der Künstler, auch der Architekt, als einfacher Handwerker. Das spiegelt sich vor allem darin wider, dass deren Namen anders als beim Bauherren praktisch nicht überliefert sind. Auch anderweitig hat sich der Künstler in seinen Werken praktisch nicht verewigt. Das beginnt erst im Spätmittelalter aufzubrechen. So gäbe es sicher unzählige Beispiele für Gesellschaften, in denen Künstler keine hohe Stellung in der Ordnung hatten. Eine natürliche Hierarchie vermag ich da nicht erkennen.
Du schreibst, moderne Architektur soll im Zeichen der Demokratie wirken. Dabei hast du vielleicht einige Länder im Kopf, bei denen dies so gedeutete werden könnte, vernachlässigst aber unzählige Diktaturen und nichtdemokratische Länder, in denen ebenso modern gebaut wird. Ich erspare es uns mehr Beispiele zu nennen als China. Diese Gleichung geht also nicht auf.
Du behauptest, moderne Architektur würde mit seiner Hässlichkeit und Unterdurchschnittlichkeit politisch gewollt sein. Erkläre mir das bitte anhand der chinesischen Megacitys der letzten Jahre, anhand der sich gegenseitig übertrumpfenden Wolkenkratzer und Retortenstädte in den Scheichstaaten in Nahen Osten oder am Guggenheim-Museum in Bilbao. Letzterem ist es gelungen, das Image und das Gesicht einer ganzen Stadt in nur wenigen Jahren komplett positiv umzukrempeln. Diese Bitte ist nicht rhetorisch gemeint.
Allein an diesen Gegenargumenten kann man erkennen, dass einfache Erklärungsmuster, die natürlich populistisch verfangen, bei der Beurteilung von moderner Architektur nicht ausreichen. Das gilt selbstverständlich für beide Lager, die der Modernisten und die der Anhänger klassischer Architektur.
-
In Holland kommt auch kein Mensch auf die "Schnapsidee", die Verkehrsberuhigungen und Radfahrerfreundlichen Räume zurückzunehmen, die seit den 70ern geschaffen wurden. Übrigens das für Autofahrer laut diverser Studien entspannteste Land der Welt.
Kann ich bestätigen. Wir sind mehrfach im Jahr in den Niederlanden, an diversen Orten. Als Autofahrer, Radfahrer und gelegentlich natürlich als Fußgänger. Was die Infrastruktur für Fahrradfahrer betrifft, gibt es kein fortschrittlicheres Land. Verblüffend dabei: Das geht eben nicht zulasten des Autofahrers. Ganz im Gegenteil. Trotz der enormen Bevölkerungsdichte ist das Autofahren dort enorm entspannt. Wenn wir demnächst nach Frankreich fahren, werden wir selbstverständlich die Route durch die Niederlande nehmen und nicht die von Navi vorgeschlagene durch Deutschland. Ich verstehe nicht, dass man sich nicht in ganz Europa mehr von den Infrastrukturkonzepten dieses Landes abschaut. Ganz speziell in Deutschland!
-
Wer Dinge in die Öffentlichkeit hinausposaunt, muss damit rechnen, dass man nachfragt, wie es gemeint ist. Wenn du damit ein Problem hast, dann kannst du dich ja der Diskussion enthalten. Den Einwurf der Verschwörungstheorie lese ich jetzt schon zum zweiten Mal hier, von mir kam er definitiv nicht. Insofern unterlasse es bitte, mir Paranoia zu unterstellen!
-
Nun Valjean hat mit keinem einzigen Wort behauptet, dass "[jemand] mit Architektur die Gesundheit der Bevölkerung schädigen" will. Das ist deine nun zum zweiten mal wiederholte Interpretation.
Nur damit sichergestellt ist, dass wir hier nicht einander vorbeireden. Die Frage lautete:
ZitatGlaubt eigentlich irgendjemand, dass diese beiden Gebäude die gleichen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung haben?
Die Antwort auf diese Frage lautete:
Als Antwort zur, auf englisch, gestellten Frage: nein, das glaube ich in der Tat nicht und ich meine auch, dass eben dies auch beabsichtigt ist.
Vielleicht fehlt mir auch nur die Fantasie, aber ich kann keine andere Interpretationsmöglichkeit erkennen, als dass hier behauptet wird, dass der negativen Auswirkungen auf die physische Gesundheit der Menschen nicht nur erkannt, sondern auch bewusst (durch wen denn nun?) in der Architektur angelegt werden. Zu so einem weitreichenden Vorwurf hatte ich Rückfragen, die ich formuliert habe. Eine konkrete Antwort dazu habe ich nicht erhalten.
-
Ich interpretiere daraus, viel sinnhafter, dass eine positive Wirkung auf die psychische Gesundheit meistens überhaupt kein Kriterium (mehr) beim Entwerfen von Gebäuden und öffentlichen Räumen ist, und das kann man daraus sehr wohl als Vorwurf ableiten, weil es eben so offensichtlich ist.
Das sehe ich ähnlich und ich glaube, das wird man sogar über unsere Kreise hinaus so einschätzen.
Dafür braucht man gar keinen Verschwörungstheorien zu folgen, um sowas zu äußern.
Niemand hat etwas von Verschwörungstheorien geschrieben.
Bei vielen von dem, was du nun schreibst, kann ich dir folgen, aber letztlich gehst du kein Stück auf meine Rückfragen ein. Wer genau möchte denn mit Architektur die Gesundheit der Bevölkerung schädigen? Du schmeißt das so einfach in den öffentlichen Raum und umgehst die zu erwartenden Rückfragen.
Ich kann auch durchaus den Erklärungsmustern von Wolfschlag etwas abgewinnen, aber wenn dabei auf Kanäle rund um die rechtsextremen Kreise von Schnellroda und Kubitschek etwas von Ideologien gefaselt wird, bin ich raus. Das sind für mich keine seriösen Medien.
-
Ich bin mir nicht sicher, ob es das gewesen ist, was Valjean gemeint hat. Warten wir doch mal ab, was er auf meine Frage antwortet.
Natürlich gibt es Misanthropen in unserer Gesellschaft, aber wie muss man sich das hier konkret in New York vorstellen? Haben sich da Architekten, Bauherren und Bauverwaltung in einer konspirativen Sitzung getroffen und vereinbart, etwas zu bauen, was der Gesundheit der Menschen schadet? Irgendwo in diese Richtung scheint doch die Anmerkung von Valjean zu zielen.
Was du übrigens von Corbusier schreibst, zielt doch in eine ganz andere Richtung. Hier kann gar nicht die Ansicht dahinterstecken, Menschen Schaden zufügen zu lassen. Denn erstens hält Corbusier seine Architektur für so schön, dass sie kein Mensch wert sei, sie zu nutzen. Und zweitens sollen sich die Menschen ja nun von seinen Bauten fernhalten, insofern kann dahinter kaum die Absichten stecken, sie zu schädigen. Corbusier ist also ein ganz schlechtes Beispiel für die Thesen von Valjean.