
Hirschbrunnenplatz im Südosten der Altstadt.
Das Haus sticht aufgrund seines grünes Daches im Luftbild heraus:
Leonberg - Google Maps

Grabenstraße

Graf-Eberhard-Straße und Blick in die Hintere Straße

Hintere Straße, Rückseiten der Häuser auf der Ostseite des Marktplatzes, rechts die Nr. 2.

Das dritte Haus von links mit freiliegendem Fachwerk ist die Rückseite von Marktplatz 10.

Rückseite vom Haus Nast (Marktplatz 26) zur Hinteren Straße.
Auf der Ostseite der Hinteren Straße überwiegend Neubauten, zumindest angepasst, giebelständig und mit rotem Dach:

Gasthaus zum Schwarzen Adler, ein eindrucksvolles, recht hohes Steinhaus mit Fachwerkaufbau (1351 erwähnt, 1427/28 dendro. dat., siehe Bauforschung BaWü) am ehemaligen Obertor im Nordosten der Altstadt:

"Der Wehrgang der Stadtmauer verlief durch den ersten Stock des Gebäudes, er ist in der Gaststube noch zu sehen, desgleichen die Wächtersitzplätze in den Fensternischen des Treppenhauses." (Tafel am Gebäude)





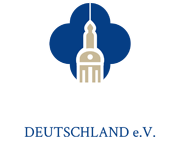
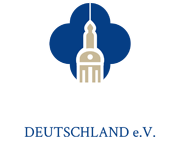


















































































 Stadtseite mit Scheublinstisch
Stadtseite mit Scheublinstisch






 Südlich anschließend ein weiteres Bürogebäude von Ende der 1980er Jahre und Durchblick zur Oberdorfstrasse. Rechts angeschnitten das Regierungsgebäude.
Südlich anschließend ein weiteres Bürogebäude von Ende der 1980er Jahre und Durchblick zur Oberdorfstrasse. Rechts angeschnitten das Regierungsgebäude.


















 Blickrichtung West mit älteren Hochhäusern
Blickrichtung West mit älteren Hochhäusern











