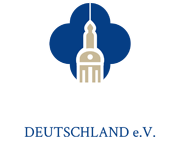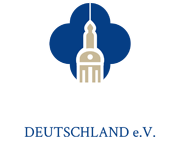Ich hätte so gern eine Zeitmaschine:
Beiträge von Sagebiel
-
-
-
Wie immer preußisch klar:
ZitatBAU: 20 Jahre Glockenspiel
Max Klaar über das christliche Preußen und die Zukunft der gesammelten Garnisonkirchen-MillionenHeute vor 20 Jahren wurde die Schenkungsurkunde für das Glockenspiel im Stadthaus überreicht. Wie dabei sein Interesse an der Garnisonkirche geweckt wurde, erzählt der frühere Chef der Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel (TPG), Max Klaar, im Gespräch mit Ildiko Röd
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11…en-und-die.html
Hätte man Klaar und die TPG damals machen lassen, und ich wiederhole mich da, würde die Kirche heute schon stehen. Schade!
-
Zitat
»Niemals sah ich eine Stadt wie Genua! Etwas unbeschreiblich Schönes, Großartiges, Eigenartiges: Paris und London verschwinden hinter dieser göttlichen Stadt.« Richard Wagner
-
Auch von mir ein Dankeschön! Ich fahre in meinem diesjährigen Jahresurlaub mal wieder nach Ligurien (die zumindest geographisch und klimatisch schönste Ecke Italiens) und freue mich auch auf Genua.
-
Ein Fachbuch zu SchortschiBährs Erklärungen, für alle, die mehr wissen wollen:
-
Neu zum Goldenen Schnitt (und schöne, aktuelle Kunst):
-
Wer morgen Zeit hat, Glockenfest der Nikolaikirche:
ZitatWeil das Ereignis ein einmaliges ist, hat die Gemeinde für den 20. März ein Glockenfest organisiert. Um 13 Uhr setzen sich die Wagen mit dem Geläut in der Lotte-Pulewka-Straße in Zentrum Ost in Bewegung. Über die Lange Brücke geht es zum Standort der Garnisonkirche, wo um etwa 13.25 Uhr Blasmusik erklingen wird. Über die Schopenhauer- und Charlottenstraße führt die Parade zu St. Peter und Paul, deren Glocken gegen 13.45 Uhr grüßend erschallen werden. Um 14 Uhr sollen die Nikolaiglocken vor ihrem Gotteshaus eintreffen. Das Bundespolizeiorchester wird spielen. Zehn Minuten später wird ein ohne Zweifel beeindruckendes Zeichen gesetzt: Alle Kirchenglocken der Stadt werden mit ihrem Läuten die Neuankömmlinge begrüßen. Bei der anschließenden Glockenandacht wird jede aus dem Quartett von ihrem Wagen gehoben und symbolisch mit einem Hammer angeschlagen. Nach Grußworten von Oberbürgermeister Jann Jakobs und Generalsuperintendent Joachim Zehner wird es fröhlich: Kaffee und Kuchen, Grill-Würstchen und eine Hüpfburg warten.
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11…es-Gelaeut.html
Im ganzen Artikel allerdings keine Wort über Oberstleutnant Max Klaar und seine TPG/SPK die die Glocken bedeutend mitfinanziert hat. Die Garnisionkirche würde wohl schon stehen, hätte man die TPG machen lassen.
http://www.preussisches-kulturerbe.de/
Aber in einer Stadt, in der solche Leidartikel über moderne Zivilcourage geschrieben werden, kann man das wohl nicht erwarten:
ZitatDerzeit sei der starke linke Block noch ein spürbares Regulativ. Die autonome Szene mache Neofaschisten das Leben schwer, sagte Polizeichef Ralf Marschall. So hätten Linke einem jungen Mann zwei Schneidezähne ausgeschlagen, weil er einen Londsdale-Pullover trug...
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11…verfestigt.html
-
Da unify ja die aktuellen Ereignisse so gut abdeckt, hier mal wieder etwas Historisches von mir:
Schlusskapitel des Buches
Martin Hürlimann und Paul Ortwin Rave "Die Residenzstadt Potsdam. Berichte und Bilder." Atlantis Verlag, Berlin, 1933.Moderationshinweis (Palantir): Bildeinbindung zwecks Seitenökonomie auf Daumennagel-Ansicht zurückgenommen.
-
-
Benni, wir sollten APH-Buttons tragen. Ich war etwa zur gleichen Zeit dort und habe mir die Liebermann und die Konferenz-Villa angesehen. Der Wannsee sieht gefroren viel kleiner aus.
-
-
Auch du, Jakobs?!
Sollte ein Sozi zur Abwechslung mal die Kommunisten verraten?ZitatAngesichts der Planungsrückstände für den Umbau und die Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek will Oberbürgermeister Jann Jakobs das fertige Finanzierungspaket noch einmal aufmachen. Die für 2010 vorgesehenen Mittel aus dem Hauptstadtvertrag wolle er für andere Maßnahmen in der historischen Stadtmitte einsetzen.
...
Jakobs widersprach sofort der aufkeimenden Befürchtung der Linken-Kulturpolitikerin Karin Schröter, dass damit nun doch der Bibliotheksstandort in Frage gestellt werden könnte.
Der Standort vielleicht nicht, aber die Fassade (und um die gehts ja wohl bei dem Streit).
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11…t-fuer-die.html
-
Tegel war kein schöner, aber überaus praktischer Flughafen, fast genial.
Die Ergebnisse des Ideenwettbewerbs scheinen mir genauso schwachsnnig wie die für Tempelhof (Büffelwiese):ZitatGeburtsstunde eines neuen Staats mitten in Berlin: der Freistaat Tegel. Dort herrscht direkte Demokratie, das Steuerkonzept passt auf einen Kronkorken (es gibt nur Umsatzsteuer) und alles ist ökologisch sehr korrekt...
Und allesamt von der armen Stadt nicht finanzierbar.
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11…er-was-aus.html
-
Ein echter Preusse?!
ZitatKlipp mehrfach mit klaren Ansagen vorgeprescht – etwa, dass Kungelei im Bauamt mit ihm vorbei sei oder dass er sich nur dem Wohl der Stadt und keiner Partei verpflichtet fühle, auch nicht seiner eigenen, den Grünen.
...setzte sich alsbald einiges in Gang, was lange verschleppt wurde: Eine „Task Force“ im Bauamt arbeitet dauerwartende Steuerbescheide für Sanierungen auf, im Nu hatte Klipp ein Leitbautenkonzept für die Alte Mitte nebst Zeitplan zur Hand...
Dem Vernehmen nach soll der Oberbürgermeister mehrfach sein Missfallen ausgedrückt und einen Maulkorb an Klipp verteilt haben – unter anderem, als der Baudezernent auf einem Forum den Standort der Bibliothek noch einmal auf den Prüfstand setzen wollte. Offenbar war die Sorge vor weiteren Vorstößen so groß, dass dem Beigeordnete ein Interview über seine ersten 100 Tage glatt untersagt wurde.
http://www.maerkischeallgemeine.de/cms/beitrag/11…scher-Wind.html
-
In der Druckausgabe war ein Bild dieses "Wackelhauses" und ich dachte, mitteschoen hätte so eine Postkarte gemacht, um zu zeiegen, wie häßlich ein Neubau wäre. Disneyland für Arme.
-
Ich träume schon länger von einem Haus in der Naumburger Innenstadt und die dortigen Preise sind ein Witz ("Kauf ich nun den gebrauchten Golf oder das Haus in Naumburg aus dem 18. Jhd.?")
Hier einige Beispiele:
http://www.sga-ag.de/index.php?id=46
Und die Preise:
Ausruf Zuschlag
141. Naumburg
Franz-Ludwig-Rasch-Straße 14 9.000,00 9.000,00
142. Naumburg
Rosa-Luxemburg-Straße 33 9.000,00 12.500,00
143. Naumburg
Rosa-Luxemburg-Straße 47 7.000,00 11.500,00
144. Naumburg
Jägerstraße 65 8.000,00 8.500,00
145. Naumburg
Moritzberg 1, 1a 4.000,00 7.000,00
146. Naumburg
Schönburger Straße 23 6.000,00 11.500,00
147. Naumburg
Schönburger Straße 27 5.000,00 6.000,00
148. Naumburg
Hinter der Pos. 4 10.000,00 14.000,00Nu. 145 hat mir gut gefallen.
-
-
ZitatAlles anzeigen
Architektur in der Bundesrepublik
Land ohne Fassung und FormDie Architektur der Gegenwart in Europa steckt in einer tiefen Krise. Sieht sich die Kunst im wesentlichen, wie schon Hans-Jürgen Syberberg 1990 feststellte, als „Interpretations-Kunst“, schnell und billig, auf kurzatmige Pointensucht fixiert, so ließe sich die Architektur in der Bundesrepublik den beiden Extremen „Effekthascherei“ oder „Unauffälligkeit“ zuordnen.
Die Architektur der letzten sechs Jahrzehnte war hierzulande im großen und ganzen eine Ansammlung von Adaptionen und Nachäffereien meist internationaler „Trends“ der modernen Schulen. Die Versuche, einen weiter den europäischen Bautraditionen folgenden Stil zu bauen, wurden in den fünfziger Jahren in der Regel zugunsten einer unaufrichtigen Pseudomoderne aufgegeben. Man war anfangs noch ungeübt im Kopieren der zuvor gemiedenen Stilrichtung. Danach tobte die Megalomanie moderner Großprojekte, welche seit den sechziger Jahren im modernen Stil des sogenannten Beton-Brutalismus mündeten: Stadtautobahnen, Hochhäuser, riesige Wohnblocks des Sozialen Wohnungsbaues, Kaufhaus-Kästen in den Innenstädten, Satellitenstädte an den Rändern.
Schlimm für die zerstörten und von historischen Bauresten „bereinigten“ Innenstädte war auch die technisch und baukünstlerisch niedrige Qualität vieler Bauten. Billigbauten füllten die Innenstädte von München, Hamburg bis Berlin. Noch heute stehen sie allenthalben in der Republik herum. Bauprogramme der Regierungen fehlen, sie flächendeckend zu ersetzen, abzureißen oder zu überbauen. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Auto-Abwrackprämie wäre übrigens ein solches Programm zumindest nachdenkenswert.
Doch ist die Zeit gegenwärtig reif, die Lücken mit vernünftiger Architektur zu füllen? Zweifel daran sind angesichts vielerorts entstehender Bauten angebracht. Wo sind die Architekten, die gut bauen, welche die Gratwanderung zwischen Unauffälligkeit und Kitsch beherrschen?
Auch die Architektur der sogenannten Postmoderne seit Mitte der achtziger Jahre zeigte wenig wirklich Qualitätsvolles an den Bauten selbst. Gleichwohl beförderte sie entscheidend das Nachdenken über das, was Urbanität und das funktionierende Leben in den Städten ausmacht. Abkehr von den sozialistischen Ideen der „Wohnmaschine“, Wiederzulassen von Wohnen und kleinerem Gewerbe in den Innenstädten waren die Folge. Bauforscher entdecken mehr und mehr, daß ökologisches Bauen in Stadt und Land tatsächlich auf traditioneller Bauweise aufbauen kann, verbunden mit moderner Technologie. „Blut und Boden“ im positiven Sinne also, verbunden mit Solarenergie. Hier ist Deutschland Vorreiter in der Welt.
Aber das Bekenntnis zur zweckmäßigen Architektur aus der Tradition, auf dem Lande aus der Landschaft heraus ist in der Bundesrepublik bisher nicht gefördert worden, was eine wirkliche Katastrophe ist, da es sich flächendeckend auf das Bauen auswirkt. Hier müßten endlich zukunftsweisende und korrigierende Regelwerke erstellt werden; eine wichtige und lange vernachlässigte Aufgabe der Bundesländer.
Seit den achtziger Jahren besannen sich die Zünfte der Stadtplaner und der Architekten, aber auch Teile der Politik, wieder auf die Stadt als Lebensraum, unter Einbeziehung und Respektierung der historischen Strukturen und baulichen Substanz. Es ging also, verbunden mit der Hinwendung zu ökologischen Konzepten, auch um eine Anerkennung der Qualitäten traditioneller Stadtstrukturen mit ihrer Verdichtung, dem Mischen von Wohnen und Arbeiten, einem maßvollen Verkehrsanteil, dem Begrünen von Straßen und Innenhöfen, dem Einhalten von Geschoßhöhen im Verhältnis zur Straßenbreite, der Wiederverwendung von Ornamenten, lange verpöntem Material, dem hierarchischen Betonen von Fenstern und Türen.
Die bauliche Entwicklung war in der frühen Bundesrepublik geprägt von der Notwendigkeit, die Verkehrswege wiederherzustellen und Millionen von Wohnungen für Entwurzelte zu errichten. Viel zu schnell und viel zu billig hatte man bauen müssen.
Dabei handelte es sich immer auch darum, die Stadtkerne wiederzubeleben. Die Städte waren seit dem Mittelalter die großen Handelsplätze, die wirtschaftlichen, aber auch kulturellen Zentren des Landes gewesen. Deutschland ist das Land der großen Städte. Um ihre Kerne, die sich um Burgen, Märkte und Kirchen gruppiert hatten, bildete sich Kultur, die unser städtisches Leben heute wieder prägt. Die Vernichtung der Stadtkerne oder ganzer Städte im Zweiten Weltkrieg hat das Bewußtsein hierfür, nie vollends tilgen können, wie sich heute zeigt.
Dennoch: Die bauliche Entwicklung war in der frühen Bundesrepublik geprägt von der Notwendigkeit, die Verkehrswege wiederherzustellen und Millionen von Wohnungen für Ausgebombte und Vertriebene zu errichten. Viel zu schnell hatte man bauen müssen und viel zu billig. Die Städte wurden an ihren Rändern zersiedelt, Innen- wie Randstadtbereiche als nicht-urbane „Wohnlandschaften“ mit freistehenden Häuserblocks auf Grasflächen mißbraucht. Diese Maßnahmen kamen einer regelrechten Verödung und Negierung der Städte gleich.
Wolf Jobst Siedler, einer der ersten prononcierten Verfechter der Besinnung auf das Erbe der deutschen Stadt nach dem Krieg, hatte schon 1964 provozierend von der Notwendigkeit der „Lust am Ungeordneten“ in den Wohnquartieren der Innenstädte geschrieben, womit er eine entscheidende Beobachtung machte: Leben entsteht in der Stadt neben den pulsierenden Geschäftszentren in den Wohngebieten durch Rückzugsräume, Nischen, wohnliche Verdichtungen, individuelle kleinteilige Architektur und Identifikationsmomente, die den Menschen der Gleichmacherei und dem Zwang zu immer gleicher Handlung auf öffentlichen Plätzen entziehen. Damit machte Siedler deutlich, daß die extremistischen sozialistischen Ideen, die immer den Zwang zur Gemeinschaftshandlung in sich tragen und in der Realität zur Nivellierung des allgemeinen Lebensstandards führen, dieses Ideal der funktionierenden Urbanität geradezu zerstören mußten.
Bezogen auf die häßlichen Trabantenstädte und jene in den Innenstädten als reine Wohnbaukomplexe vollkommen deplazierten Einzelbauwerke des Sozialen Wohnungsbaus der sechziger und siebziger Jahre, können diese sozialistischen Experimente als vollkommen gescheitert angesehen werden. Siedler empfahl wirksam und mit anschaulichen Argumenten, die Notbremse zu ziehen: Es gilt, das Historische zu erhalten wie auch das Bewährte in Stadtplanung und Städtebau wiederaufzugreifen.
Neben der städtebaulichen und architektonischen Reparatur der Innenstädte, die immerhin seit dieser Zeit – zunächst von wenigen – als Notwendigkeit erkannt wurde, entstehen aber auch heute architektonisch symbolhafte Bauten von Parlament und Staat, die zum genauen Hinsehen zwingen und Widerspruch provozieren müssen: Rund um das Reichstagsgebäude in Berlin konzentriert sich ein Sammelsurium propagandistisch gedachter Riesenbauten, die den Staat – oder besser die Bürokratie des Bundes – in der neuen Hauptstadt feiern. Im wesentlichen sind jene aufgeblasenen Bundesbürobauten aus simplen und allzu glatten Beton- und Glasflächen zusammengesetzt und bleiben dem Betrachter als Form nur grob in Erinnerung.
Das Bundeskanzleramt, aber auch die ganze umliegende Flachdacharchitektur des sogenannten „Bandes des Bundes“, jener stadtplanerischen Idee also, die den dortigen Spreebogen ignoriert und den Flußlauf selbst zerschneidet, ist ein prominentes Beispiel für die unausgereifte architektonische Formensprache der Republik, die weder ästhetisch noch technisch oder bauhandwerklich irgendwelche Maßstäbe setzt. Diese Bauten sind von einer Billigkeit, die staunen macht. Ihre Fassaden bröckeln, Bauteile lösen sich, nach wenigen Jahren schon sind sie Sanierungsfälle geworden. Die neuerrichteten Parlaments- und Regierungsbauten verströmen das ganze Gegenteil von Großzügigkeit und demokratischem Machtbewußtsein. Sie sind, gerade auch in ihren Innenräumen, Paradebeispiele für Kleinmütigkeit, Piefigkeit, Spießigkeit.
Ein Besuch des Kanzleramts verdeutlicht: Ein Bau, welcher dem Hereintretenden durch heruntergezogene Decken das Gefühl von Klaustrophobie vermittelt, kann wohl noch nicht allen Ernstes das letzte Wort in der Frage der architektonischen Verortung der Republik sein. Das Gespür für angemessene Repräsentation muß hierzulande erst neu gelernt werden. Wie auch die Vereidigung der Bundeskanzlerin eben erst wieder gezeigt hat: Dieser Staat versteht es noch nicht, sich zu feiern.
Das Perikleische Zeitalter, die Blütezeit des attischen Staatswesens, kündet heute noch mit der Akropolis von der Baukunst als Ausdruck des Selbstbewußtseins seiner demokratischen Herrschaft. Diese war tatsächlich Volksherrschaft. Architektur dieser Demokratie war zugleich also schon Symbol für Macht nach innen und außen. Athen war übrigens damals auch Kolonialmacht. Selbst Rom trachtete die Monumentalität der Anlagen Griechenlands zu imitieren, ja zu übertreffen. Die abendländische Architektur kannte bis um 1000 n. Chr. nichts Vergleichbares. Erst die gewaltigen Kirchenbauten des Mittelalters reichten an die schöpferische und monumentale Gewalt der Anlagen des Klassischen Altertums heran.
Und dennoch: Es gibt keine „demokratische Architektur“, ebensowenig wie es eine „undemokratische Architektur“ gibt. Der Begriff der Architektur aber lädt, von dieser Erkenntnis unberührt, politische Schwärmer ein, sich seiner zur Erreichung politischer Ziele wegen zu bemächtigen und ihn zu einem effektiven politischen Instrument in der Auseinandersetzung um die Meinungsführerschaft zu machen. In den Jahren der politischen Neuordnung nach 1945, in der Bundesrepublik, gab es erstaunlicherweise einen breiten politischen Konsens darüber, was „demokratisch“ und was „undemokratisch“ in der Baukultur war. Glas galt und gilt vielen als besonders „demokratisch“, da transparent, Stein dagegen als „faschistisch“.
Jenseits solcher Demagogie, die sich wohl auch aus Verklemmtheit speiste, sollte sich heute der Staat seiner ihm vom Volk übertragenen Macht bewußt werden und diese auch baulich zeigen, sollte es Architektur geben, die Würde und Macht des Staatswesens und seiner höchsten Repräsentanten ausstrahlt. Diese Architektur muß auch in Deutschland immer legitim sein. 80 Millionen Bürger werden repräsentiert, nicht 80 Millionen Konsumenten einer Kaufhauskette.
Das neue Bundeskanzleramt im Spreebogen, welches dem Hereintretenden durch heruntergezogene Decken ein klaustrophobisches Gefühl einflößt, kann doch nicht allen Ernstes das letzte Wort in der Frage der architektonischen Verortung der Republik sein.
In den fünfziger Jahren noch wurde auf Bundes- und kommunaler Ebene die totale Abkehr von der aus europäischen, vor allem barocken Traditionen erneuerter Repräsentations- und Herrschaftsarchitektur des Nationalsozialismus vollzogen. Die noch erinnerte Neue Reichskanzlei, Gauforen, Gemeinschaftshäuser und die großangelegten Pläne für Berlin waren gleichsam bild- und symbolhaft der Realität einer Bungalow-Architektur gewichen, also einer miniaturhaften Verkleinerung dessen, was Repräsentation der Regierung sein könnte. Dieser Prozeß bewußter Abkehr der Kunst von ihrem abendländischen Hintergrund vollzog sich ebenso in den Bildenden Künsten, und hier vielleicht noch peinlicher.
Vor diesem Hintergrund entstehen heute so viele mittelmäßige, uneindeutige, pseudorepräsentative und halbherzige Regierungs- und Staatsbauten, das wirkliche bauliche Bekenntnis zur demokratischen Macht fehlt.
Auch heute wird um die Deutungshoheit über Architektur gerade im öffentlichen Raum gerungen, von der Politik über Journalisten bis hin zu Architekten und Künstlern. Erstaunlich ist, daß gerade in der bundesrepublikanischen Ausformung der Demokratie der Begriff des „Demokratischen“ zum Mittel der Kunstpolitik und der Ausmerzung nicht genehmer künstlerischer Formen benutzt wurde. Insofern wird hier ein Herrschaftsanspruch laut, der diesmal nicht die sogenannten „Entarteten“ und Bauhaus-Modernen, sondern die abendländisch-traditionellen, die klassischen Ausdrucksformen zu unzeitgemäßen und auszuschaltenden Erscheinungen stempelt.
Bei alledem stellt sich die Frage nach dem Stellenwert der Architektur an sich im öffentlichen Leben und der gegenwärtigen Kunst. Sie ist, so scheint es, Teil des Problems des Zeitgeistes in einer Epoche des Billigen, Vergänglichen, der Wegwerfkultur geworden. Die Internationalisierung und Standardisierung der Formen und Techniken führt neben dem kurzfristig verlockenden finanziellen Nutzen zwangsläufig zu einer Verflachung und Austauschbarkeit.
Ob es unter diesen Bedingungen zu großen und in die Zukunft weisenden baukünstlerischen Kulturleistungen in Deutschland kommen kann, ist gegenwärtig fraglich. Zwar profitieren die Städte heute immer noch stark von der erhalten gebliebenen historischen Bausubstanz und dem alten Stadtgrundriß. Auch in den neuen Kernen der kriegszerstörten Städte wird sich auch künftig das Leben um die alten Wahrzeichen herum verdichten. Aber es fehlt heute gerade in Deutschland der Wille und die künstlerische Kraft, Großbauten zu errichten, die Wegmarken setzen könnten. Allenfalls greift man zu Ersatzlösungen, um von der eigenen Kraftlosigkeit abzulenken: Der Bund baut nun das Berliner Schloß wieder auf – jedoch bewußt, ohne es politisch zu nutzen. Allein daran kann man messen, daß die Architektur der Bundesrepublik noch vor großen Herausforderungen steht.
© JUNGE FREIHEIT 46/09 06. November 2009
-
Zitat von "Heimdall"
Ich möchte heute mal auf eine eine interessante Buch-Neuerscheinung hinweisen, die viele der in diesem Forum besprochenen baulichen Problemfelder ausführlich behandelt bzw. auf ihre Ursprünge zurückführt:
Norbert Borrmann: Kulturbolschewismus oder ewige Ordnung. Architektur und Ideologie im 20. Jahrhundert, Graz, Ares-Verlag, 2009
Ich habe mir das Buch auch gekauft und es hat mich sehr interessiert. Schön illustriert, bietet es eine Architekturgeschichte des XX. Jahrhunderts (mit Schwerpunkt Deutschland), die den Einfluß der Weltanschauungen berücksichtigt.
Bei amazon gibt es für Interessierte die "Blick ins Buch Funktion":