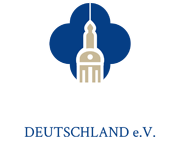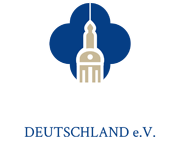Da hilft es auch nicht Potsdam mit fast 200.000 Einwohnern als "Kleinstadt" abzuqualifizieren, um sich besser zu fühlen. Ich kann die Frustration ja verstehen, aber wir in Potsdam können nun wirklich nichts dafür.
Hm, Konstantin, auf wessen persönliche Mitteilungen zu den kleinstädtischen Kungeleien in Potsdam ich mich dabei eventuell beziehe, weiß Du selbst wohl am besten.
sondern versuche lediglich Realismus anzumahnen
Danke, aber davon haben wir mehr als genug. An jedem einzelnen Tag. Wie ich bereits sagte: einfach zu verkünden, es hört doch keiner auf uns und es wird eh alles sch... , ist für mich kein Realismus, sondern Defätismus. Realismus schließt die Möglichkeit ein, dass Dinge auch mal in die richtige Richtung gehen können, wenn die richtigen Personen im richtigen Moment die richtigen Vorschläge aufnehmen und umsetzen. Nur müssen sie dafür eben erstmal vernehmbar geäußert worden sein.
Manchmal geben Kleinigkeiten oder halbzufällige Personenkonstellationen den Ausschlag. Nehmen wir die Gestaltung des Schloßumfelds als Beispiel: es ist inzwischen bekannt, dass bei den entscheidenden Diskussionen zur Vorbereitung der Wettbewerbsausschreibung nur zwei oder drei Personen, die gegen eine historische Gestaltung waren, sich auf Grund der damaligen Anwesenheits- und Kräfteverhältnisse durchgesetzt haben. Es hätte durchaus auch anders ausgehen können. Zur Gestaltung der Neubauten im Quartier III in Potsdam hattest Du ja selbst berichtet, dass in den entscheidenden Sitzungen ein paar Parteienvertreter nicht anwesend waren, die den Ausschlag für ein besseres Ergebnis hätten geben können.
Die meisten Politiker nehmen durchaus sensibel wahr, in welche Richtung die öffentliche Meinung geht. Meinungsumfragen spielen für viele von ihnen eine größere Rolle, als es für unser Gemeinwesen möglicherweise gut ist. Ich erinnere daran, dass es eine einzige Meinungsumfrage der Berliner Zeitung war, die für unsere Bundeskanzlerin 2010 den Ausschlag gegeben hat, den Wiederaufbau des Berliner Schlosses auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Nur die Notwendigkeiten des U-5-Tunnelvortriebs ermöglichten 2012 dann doch einen Baubeginn.
Was können wir also machen? Uns zusammenschließen. Öffentlichkeitsarbeit über die Medien und unsere eigenen Publikationskanäle. Entscheider anschreiben und wenn möglich persönlich ansprechen. Die Mehrheitsmeinung über seriöse und qualitativ hochwertige Umfragen quantifizieren.
man scheint kritikunfähig
Meinst Du das ernst?
Ernsthaft zu glauben eine städtische Wohnungsbaugesellschaft könnte mit einem Gestaltungshandbuch zum schönen Bauen gebracht werden ist bestenfalls naiv. Ist der Baukörper erstmal > 20 Meter lang, die Bauten 7 Geschosse hoch und sind die Treppenhäuser sparsam gesetzt kann dabei nur eine uniforme Großwohnanlage herauskommen, und die wird aus Kostengründen sicher nicht mit Sandstein verkleidet.
Zum Molkenmarkt wird es ein Gestaltungshandbuch geben und dann Architekturwettbewerbe. Was dabei herauskommt, muss man eben abwarten.
Bezüglich der Breiten Straße - um zum Thema zurückzukommen - möchte ich aus einer nichtprivaten Antwort aus der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf das Schreiben der Bürgervereine zitieren:
"Die Gestaltungsregeln (für die 5 Neubauten an der Breiten Straße) umfassen beispielsweise eine Dreigliedrigkeit in Sockelzone, Obergeschosse und Dachabschluss. Auch werden Anforderungen bezüglich der Farb- und Materialwahl gestellt: Bevorzugte Fassadenmaterialien sind Ziegel, geschlämmter Ziegel, Putz, Fliesen und Keramik. Die gewünschte Farbpalette variiert zwischen grau, grau-grün und grau-beige."