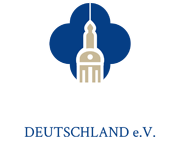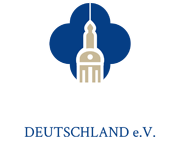Ich habe jetzt mal zu dem Thema eine Frage in eigener Sache. Ich bitte besonders Sachverständige (Bauingenieure, Fachwerkexperten) um Mithilfe.
Ich wohne zur Miete im Erdgeschoss eines Fachwerkhauses aus dem Jahre 1895. Die Vermieter-Familie wohnt im Geschoss darüber.
Meine Frau und ich haben ein Problem mit Schimmel in der Wohnung, besonders im Bereich der Fenster. Wir bekamen den Tipp, dass wir zu wenig gelüftet haben. Da war auch etwas dran, denn seit wir mehr lüften, ist das Problem kleiner geworden.
Jetzt in diesem sehr kalten Winter tritt das Problem wieder stärker auf - zwar nicht in dem Maße, wie es vorher bei dem schlechten "Lüftungsverhalten" auftrat, aber trotzdem in einem sehr ärgerlichen Maße. Aber sehr viel mehr lüften, als wir das jetzt tun, kann man eigentlich nicht mehr. Es gibt zwar im Internet einige Leute, die meinen, man sollte dann einfach über den Tag verteilt 2-4 mal alle Fenster aufreißen, aber 1. ist das im Winter sehr unangenehm und 2. wer kann das schon über den Tag verteilt machen, wenn beide Bewohner der Wohung einer Arbeit nachgehen (ich kann nicht in der Mittagspause nach Hause fahren). Ich denke, wenn tatsächlich so ein intensives Lüftungsverhalten notwendig wäre, um den Schimmel ganz zu verhindern, dann kann eigentlich mit dem Haus etwas nicht stimmen.
Ich meine mich zu erinnern, dass der Vermieter gesagt hat, dass neue Fenster eingesetzt wurden, bevor wir eingezogen sind. Ganz sicher bin ich aber nicht, ich muss das erst noch verifizieren. Hier sind jetzt meine Fragen:
- Kann es sein, dass die zu gut isolierten Fenster das Problem darstellen ("Fachwerkhäuser müssen atmen"-Argument?)
- In der Wohnung des Vermieters oben drüber tritt das Problem offensichtlich nicht auf. Kann das darin liegen, dass diese Wohnung eben direkt unterm Dach ist? Oder daran, dass er oben einen offenen Kamin hat, der auch genutzt wird (und unsere Wohnung im Erdgeschoss hat das nicht)?
- Kann es sein, dass "mehr lüften" zwar durchaus hilft, letztlich aber ein Herumdoktern an den Symptomen darstellt und nicht an der Krankheit?
Mittlerweile tritt der Schimmel in leichter Form auch in Zimmerecken auf, vorausgesetzt die Ecke ist an einer Außenwand...
Ich bitte um Rat...