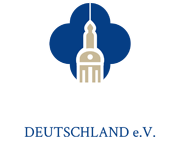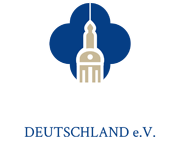Diesen sehr interessanten Artikel von Dankwart Guratzsch fand ich in DIE WELT vom 27.05.06
Propaganda für die Platte
Halle - "Kolorado Neustadt" überschreiben Markus Bader und Christof Mayer ihren Aufsatz im gerade erschienenen Heft "Stadtumbau in Großsiedlungen" des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung, Berlin. Am Beispiel Halle-Neustadt propagieren sie darin ein neues Planungsziel für den Stadtumbau Ost. Nicht mehr der Rückbau von außen nach innen, sondern die "Difersifizierung" der Großwohnsiedlungen solle angestrebt werden, um deren "Bedeutung innerhalb der Gesamtstadt zu stärken".
Nach der "perforierten" nun also die "diversifizierte Stadt" - ein Planungsleitbild, das dazu dienen soll, die aus gleichförmigen Typenbauten bestehenden Stadtrandsiedlungen durch Einteilung in separat zu entwickelnde "Felder" für die unterschiedlichsten Zielgruppen wieder attraktiv zu machen. Warum?
Seit der Wende haben sich die Großwohnsiedlungen zu Problemgebieten sowohl im Osten wie auch im Westen Deutschlands entwickelt. Allerdings nicht, weil sie - wie Wendelin Strubelt in demselben Heft meint - schlechtgeredet wurden, sondern weil ihnen die Bewohner abhanden kommen. Das Beispiel Halle-Neustadt, dem nach Berlin-Marzahn zweitgrößten städtebaulichen Projekt der DDR: Die Einwohnerzahl verringerte sich von 91000 auf 54000, jede fünfte der 35300 Wohnungen steht leer. Bis 2010 sollen sich die Leerstände auf 10000 erhöhen, obwohl, was der Bericht verschweigt, bereits zu D-Mark Zeiten mehr als 500 Mio. Euro in die Aufmöbelung des Stadtteils gesteckt worden sind.
Der Grund für die nachlassende Beliebtheit der Großsiedlungen liegt in Halle wie in fast allen Städten Ostdeutschlands in der Kehrtwende der Baupolitik. War es das erklärte Ziel der DDR-Führung gewesen, die mittelständischen Eigentümerstrukturen zu zerschlagen und die alte, "feudal" und "bourgeois" geprägte Stadt physisch in den Ruin zu treiben, so rehabilitierte das wiedervereinigte Deutschland die Altbaugebiete und unterstützte ihre Sanierung mit Förderprogrammen.
Das Resultat setzte die Politiker und besonders die Theoretiker des Städtebaus in Staunen. Die sanierten Altbauten erwiesen sich als vollauf konkurrenzfähig gegenüber den modernen Großtafelbauten. Mehr noch: Sie warben der unfertigen "sozialistischen Stadt" an der Peripherie die Mieter ab. Aus den zu DDR-Zeiten leergezogenen Innenstädten wanderten die Leerstände in die Plattenbauten am Stadtrand. Die "sozialistische Idealstadt", laut Bader/Mayer der "städtebauliche Gegenentwurf zur historischen gewachsenen Stadt", wurde zum Auslaufmodell.
Bei schrumpfender und alternder Bevölkerung, so die Prognose der Autoren, wird sich der Trend noch verstärken: "Wenn in absehbarer Zeit die aktuell im Rentenalter befindliche Generation der Gründer ausstirbt, werden die Einwohnerzahlen in den Großsiedlungen nochmals sprunghaft zurückgehen". Dann aber würden sich auch Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen bei gleichbleibenden Betriebs- und Instandhaltungskosten als hoffnungslos überdimensioniert erweisen, und zum Beispiel Bibliotheken, Parkanlagen und öffentlicher Personennahverkehr "nicht mehr finanzierbar" sein.
Diesem apokalyptischen Bild setzen die Autoren die "Hauptforderung" entgegen, der Plattenbausiedlung Halle-Neustadt "im gesamten Stadtgefüge Halles eine herausragende Rolle zu geben" und sie neben der Altstadt als "zweiten urbanen Pol" zu entwickeln. Es würde die Umkehrung der Prioritätensetzung bedeuten, die mit den "integrierten Stadtentwicklungskonzepten" für die Ostdeutschen Länder beabsichtigt war. Denn diese sollten immer in die Betrachtung der Gesamtstadt eingebettet sein - und zwar aus wohldurchdachtem Grund: Bei schrumpfender Bevölkerung wird der Mieter zur Mangelware, mit der haushälterisch umgegangen werden muß. Wer einen "zweiten urbanen Pol" schafft, nimmt dem anderen Pol die Existenzgrundlage weg.
Das Neue nicht nur in Halle, sondern auch in Städten wie Chemnitz, [lexicon='Leipzig'][/lexicon], Weißenfels ist, daß die Phalanx der Großvermieter - Wohnungsgesellschaften, Genossenschaften und Kommunalbehörden - die Abwanderung der Mieter umzulenken versucht, um die Hauptmasse der eigenen Besitzstände zu retten. Dafür kann der folgende Schlüssel gelten: Ein Hochhaus mit 150 Wohnungen entspricht der Kapazität von 15 Gründerzeithäusern. Kann ich dieses halten, sind jene vom Markt zu nehmen.
Gerade das Beispiel Halle zeigt, was dies für die Gesamtstadt bedeutet. Wenn Ricarda Ruland in derselben Broschüre unterstreicht, in Zukunft werde es entscheidend sein, "daß die Städte ihre Identität weiterentwickeln", und wenn sie dabei der "Bestandserhaltung im Altbau ... eine wichtige Rolle" zuweist, so erscheint die gezielte Förderung eines "zweiten Pols" diesem Ziel eher abträglich. Dennoch hat sie, gleichsam durch die Hintertür, sogar schon Eingang in die Förderpolitik gefunden. Ruland: "Waren in der ursprünglichen Konzeption noch 50 Prozent der Finanzmittel für Aufwertung vorgesehen, so haben einige Länder bis zu 80 Prozent der Fördermittel zugunsten des Abrisses eingesetzt".
Das hat zu einer Situation geführt, die die Autorin so beschreibt: "Trotz des mancherorts mittlerweile festzustellenden Trends der Rückkehr der Bevölkerung in die Innenstädte und einer steigenden Nachfrage nach sanierten Altbauten sind noch immer viele für das Erscheinungsbild der Innenstadt wesentliche Gebäude vom Verfall und mittlerweile sogar wieder vom gezielten Abriß bedroht".
Beispiele wie Chemnitz, [lexicon='Leipzig'][/lexicon], Weißenfels scheinen das auf beklemmende Weise zu belegen. Hier haben sich die Großvermieter gegen die mittelständischen Haus- und Grundbesitzer durchgesetzt und dem Stadtumbau ihren Stempel aufgedrückt. In Halle gingen sie mit Klagen und Schadensersatzforderungen gegen die Rückbaupläne vor. Daß damit "die Umsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes auf Jahre blockiert" wurde (Bader/Mayer), ist die eine Seite. Die andere fällt schwerer ins Gewicht: der Verfall in einer der schönsten Altstädte Deutschlands geht weiter.
Ich finde der Artikel zeigt deutlich, dass es genauso wichtig bei unserer schrumpfenden Bevölkerung ist, die Plattensiedlungen in den Außenbezirken rückzubauen als in der Innenstadt, um die Infrastruktur nicht zu überdehnen. In Dresden ist das ja auch das Problem: Früher hatte die Stadt 630000 Einwohner und war kleiner, heute müssen nur 470000 die größere Ausdehnung der Infrastruktur zahlen.
Und Dresden zeigt auch was passiert wenn man einen zweiten Pol schaft: Dort sind die Vorstädte urbaner und lebendiger als das Zentrum. Man hat dann natürlich enorme Probleme, das Zentrum wieder zu beleben, wenn dort kaum jemend wohnt und die Vorstädte attraktiver sind.
Warum [lexicon='Leipzig'][/lexicon] im Kern einen besseren Eindruck macht als Halle ist mir jetzt auch klar. Das arme Halle: Noch ist es fast genauso schön wie Erfurt oder Lübek. Noch... ![]()
![]()
![]()